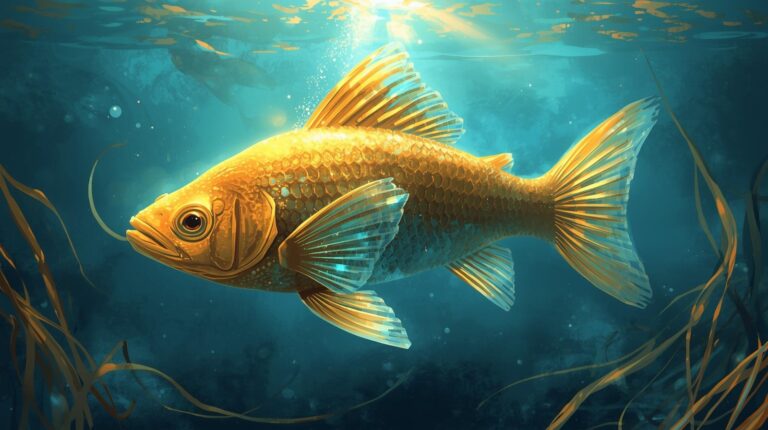Der letzte Zug

Ingrid hatte sich die Freiheit herbeigesehnt und nun, da sie sie besaß, erstickte sie beinahe daran. Ihr Leben war jahrzehntelang ein Orchester des Dienens gewesen. Der Lärm der Kinder, die von der Schule kamen, das unermüdliche Summen der Waschmaschine, das Telefon, das ständig klingelte und in den letzten Jahren das leise, aber fordernde Klingeln der Glocke am Bett ihres kranken Mannes. Sie war Ehefrau, Mutter, Krankenschwester. Ihre Identität definierte sich durch die Bedürfnisse anderer. Ihre eigenen Freundschaften waren in diesen Jahren der intensiven Pflege still und leise verkümmert, wie Pflanzen, die man vergisst zu gießen. Für einen Kaffee mit einer Freundin war keine Zeit, für ein langes Telefonat keine Kraft. Sie hatte funktioniert, tag für Tag und dabei unbemerkt den Kontakt zu ihrem eigenen Ich verloren. Nun war da Stille. Eine so vollkommene ohrenbetäubende Stille, dass sie manchmal das Ticken der Küchenuhr als einen Gnadenstoß empfand. Die Wohnung war makellos sauber, denn putzen war eine der wenigen Tätigkeiten, die die endlosen Stunden füllten. Aber die Ordnung war kalt, museal. Ingrid fühlte sich selbst wie ein Relikt aus einer anderen Zeit, eine Kümmerin ohne jemanden, um den sie sich kümmern konnte. Sie war nicht einfach nur unglücklich, ihr Zustand war komplexer. Es war der leere Sieg einer Soldatin, die den Krieg gewonnen hatte, nur um festzustellen, dass das Schlachtfeld ihr einziges Zuhause gewesen war. Die ersehnte Freiheit offenbarte sich als Exil. Sie war endlich frei von Pflichten, aber diese Freiheit war eine Lehre, die sie nicht zu füllen wusste. Deshalb ging sie zum Hauptbahnhof. Es war kein bewusstes Ziel, eher ein Instinkt. Sie ging dorthin, um den Puls des Lebens zu spüren, der in ihren eigenen Adern nicht mehr zu schlagen schien. Sie setzte sich auf eine Bank, zog ihren Mantel enger und sah zu. Dem Weinen bei Abschieden, der ekstatischen Freude bei der Ankunft, dem geschäftigen Treiben von Menschen, die ein Ziel hatten. Sie war die unsichtbare Zuschauerin und in diesen Momenten war ihre eigene Lehre ein wenig erträglicher, weil sie sich im Lärm der anderen verlor. An jenem kühlen Herbstabend saß sie wieder auf einer der abgenutzten Bänke. In diesem Moment erblickte sie ihn, einen jungen Studenten, dessen Gesicht von Verzweiflung gezeichnet war. Er ließ seine kleine Pappschachtel auf der Bank gegenüber zurück. Ingrid wandte den Blick ab. “Nicht mein Problem”, sagte eine laute, fast aggressive Stimme in ihrem Kopf. Es war die Stimme der Frau, die sich nach Frieden sehnte, die endlich einmal nur für sich selbst verantwortlich sein wollte. “Ich habe genug getan.” Sie stand auf, bereit zu gehen, doch ihre Füße gehorchten ihr nicht. Wie von einer unsichtbaren Macht gehalten, setzte sie sich auf eine Bank etwas abseits. Ihr Blick war scheinbar ins Leere gerichtet, doch ihre ganze Aufmerksamkeit galt der einsamen Schachtel, und dann, als die große Bahnhofsuhr sich der zehnten Stunde näherte und die Halle sich lehrte, drang in die gespenstische Ruhe ein Laut, so fein und anklagend, dass er Ingrids Herz traf wie ein Nadelstich, ein Wimmern aus der Schachtel. Erst jetzt wurde die anonyme Kiste zu einer Verantwortung. Sofort begann ihr Verstand, eine Mauer zu errichten. “Ich bin zu alt dafür”, flüsterte sie sich selbst zu. “Was wäre, wenn ich krank werde? Wer würde sich dann kümmern?” Genau in diesem Moment des inneren Kampfes dröhnte die blecherne Stimme aus den Lautsprechern: “Letzter Aufruf für den Intercity nach Hamburg. Der letzte Zug. Die Worte trafen sie mit unvorhergesehener Wucht. Sie verstand, dass dies nicht nur für den Zug galt. Wenn sie jetzt ging, überließ sie dieses Wesen seinem Schicksal. Dies war ihre letzte Chance, eine Entscheidung zu treffen, statt das Leben einfach über sich ergehen zu lassen. Langsam, als ob sie gegen einen unsichtbaren Widerstand ankämpfte, erhob sie sich von der Bank. Es war kein freudiger Entschluß, sondern die stille Kapitulation vor ihrem eigenen Herzen. Ihre Hände, die solange nur Leere gehalten hatten, griffen zögernd, dann aber fest um die Kiste. Sie hob die Schachtel an und blickte hinein. Darin ein kleines Bündelf, das am ganzen Leib zitterte, und dann begegnete sie seinen Blick. Zwei dunkle Augen, die sie aus der Enge der Kiste ansahen, voller Angst, aber auch mit einem Funken bedingungslosen Vertrauens. “Na gut”, hauchte sie kaum hörbar. “Du hast gewonnen.” Sie schloss für einen Moment die Augen. Dann griff sie mit entschlossenen Händen nach der Schachtel. Auf dem Weg nach draußen. In die kalte Nachtluft blickte sie sich nicht um. In ihrer Wohnung war die Stille wie weggeblasen, ersetzt durch das leise Tapsen winziger Pfoten auf dem Parkett, durch neugieriges Schnüffeln und ein zufriedenes Seufzen. Als das kleine Wesen sich schließlich zu ihren Füßen zusammenrollte und seinen Kopf auf ihren Schuh legte, senkte Ingrid ihre Hand. Die Berührung des warmen, weichen Fels war der erste Dialog, den sie seit langer Zeit führte. Sie begriff, dass dies keine auferlegte Pflicht war. Dies war eine Verantwortung, die sie sich selbst gewählt hatte, und in der Stille ihres Zuhauses war nun keine Lehre mehr, sondern Erwartung.